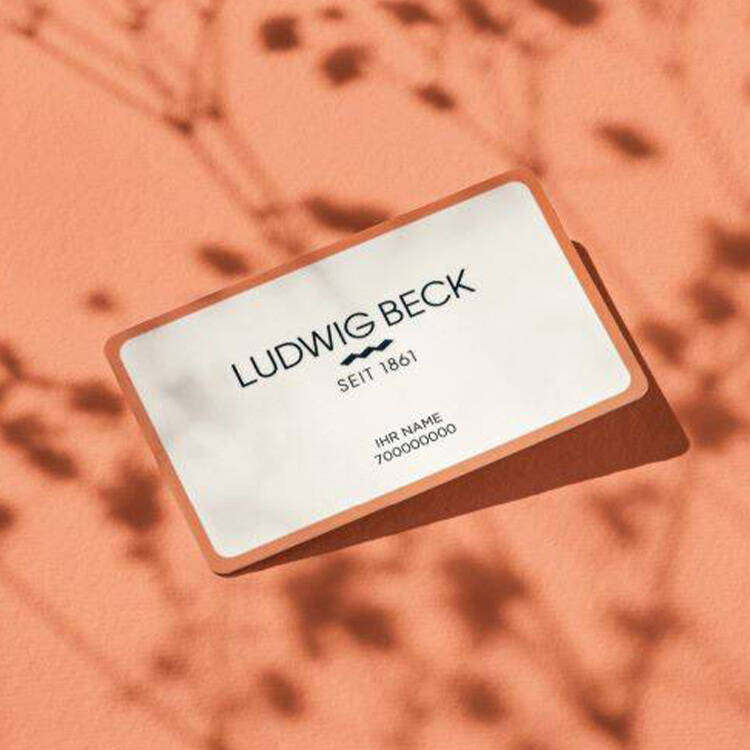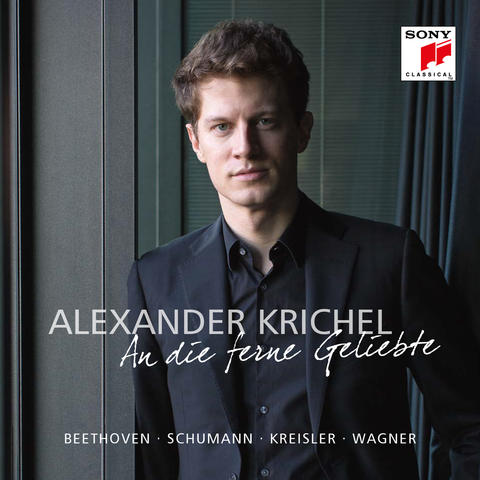
1 CD
Sony Classical
Erhältlich seit 01.02.2019
Liebesfreud und Liebesleid
Der Liederkreis „An die ferne Geliebte“ op.98 entstand im April 1816. Beethoven hatte ihn als Auftragswerk eines seiner Gönner, dem Fürsten Lobkowitz, komponiert. Er fasste darin sechs Gedichte des Medizinstudenten Alois Jeitteles über das Klagen und Sehnen nach der fernen Geliebten zu einer durchgehenden Geschichte zusammen. Die so entstandene Form des Liederzyklus, in dem die Naturschilderung ins Verhältnis zu innerlicher Kontemplation und Reflektion über Sehnsucht und Verlust gesetzt wird, fand später in Franz Schuberts „Schöner Müllerin“ (1823) und vor allem der „Winterreise“ (1827) ihre Vervollkommnung. Beethovens einziger Liederzyklus, entstanden in zeitlicher Nachbarschaft zu den beiden Cellosonaten op.102, nimmt in seinem nicht eben umfangreichen Liedschaffen einen herausragenden Platz ein. Franz Liszt transkribierte ihn 1849 für das Klavier.
Mit Robert Schumanns „Symphonischen Etüden“ op. 13, dem zweiten Schwerpunkt dieser sehr persönlichen Platte, hat es in mehrerer Hinsicht seine besondere Bewandtnis. 1837 erschienen, bilden die „Symphonischen Etüden“ einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entstehung der späteren großen Instrumentalwerke des Komponisten. Schumann hatte sie 1834 als in sich geschlossenen Zyklus komponiert, insgesamt 18 vollständige Variationen, sowie einige Entwürfe, später wählte er zwölf von ihnen zur Veröffentlichung aus. Das Thema für die „Symphonischen Etüden“ stammt von Ignaz Ferdinand Freiherr von Fricken, der nicht nur Flötist und Musikliebhaber war, sondern fast auch Schumanns Schwiegervater geworden wäre. Aber eben nur fast, denn Robert Schumann löste die Verlobung zu Ernestine von Fricken wieder - just zu der Zeit, da die Liebe zu Clara Wieck, der Tochter seines Klavierlehrers, schon unumkehrbar war. Clara hatte in einem öffentlichen Konzert am 13. August 1837 die Erstaufführung der „Symphonischen Etüden“ gespielt. Für Robert Schumann ein deutliches Zeichen ihrer schmerzlichen Sehnsucht nach ihm, suchte doch Friedrich Wieck mit aller Macht diese Verbindung zu verhindern.
Signifikant Schumanns Bemühen darum, die engen Gattungsgrenzen der kleinen Klavierform zu erweitern. Nicht nur, dass neben den fünf Variationen auch die sieben so bezeichneten „Etüden“ – eigentlich Übungsstücke – als ausgewachsene Variationen gelten konnten. Ihre Form selbst kommt innerhalb dieses Zyklus ungewöhnlich vielfältig daher, sowohl, was ihren Anspruch an die spieltechnischen Fähigkeiten des Pianisten als auch ihren Umfang betrifft, wie beispielsweise die mit „Allegro Brillante“ bezeichnete XII. Etüde. Sie ragt von ihrer Anlage her weit über die vorangehenden Teile des Zyklus hinaus und bildet gewissermaßen dessen opulentes Finale in Dur.
Fritz Kreislers Sammlung „Alt-Wiener Tanzweisen“enthält drei kurze Stücke für Violine und Geige. Wann genau er sie komponierte, ist nicht bekannt, 1905 wurden sie veröffentlicht. Kreisler Freund Sergej Rachmaninoff transkribierte zwei von ihnen für das Klavier: „Liebesleid“ und „Liebesfreud“.
Die Liszt’sche Transkription von Richard Wagner „Isoldes Liebestod“ beschließt dieses sehr persönliche Album Alexander Krichels.