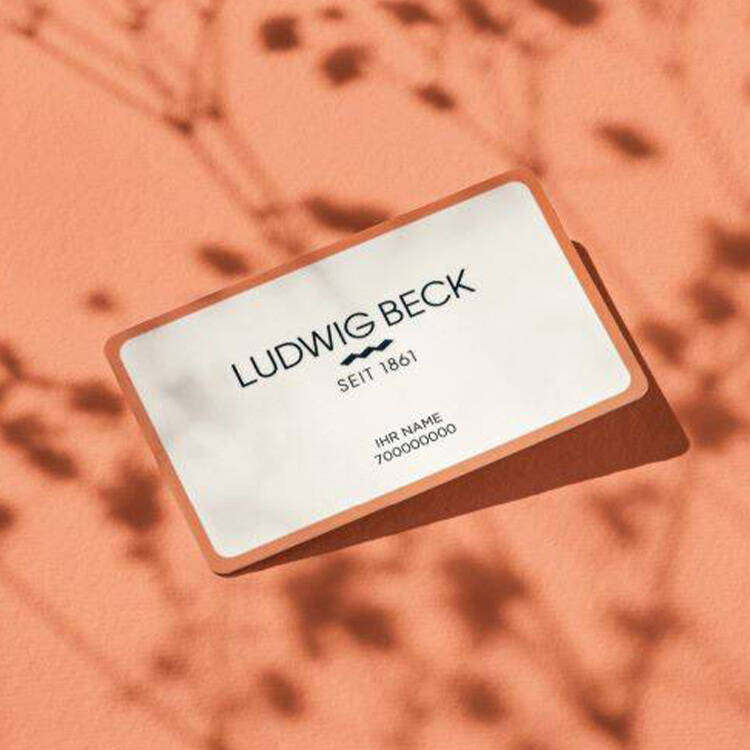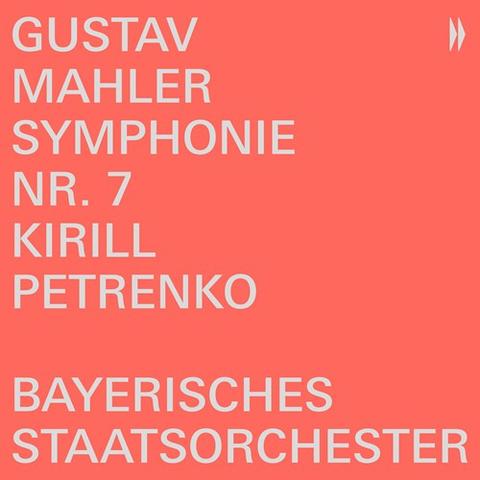
"Mahler 7. Sinfonie"
BAYERISCHE STAATSOPER RECORDINGS
Lange hat Gustav Mahler mit sich gerungen, ehe er die Arbeit an seiner 7. Sinfonie zu seiner Zufriedenheit abschließen konnte. In seinen Erinnerungen beschreibt er jenen Sommer 1905, als er fortsetzen wollte, was er im Vorjahr bereits begonnen hatte. Eigens dafür reiste er von Wien aus an den Wörthersee, in sein Feriendomizil. Sommerfreuden, schöne Landschaft – die Inspiration blieb dennoch aus. Auch ein fluchtartiger Ausflug in Dolomiten konnte die Schreibblockade nicht beenden. Verdrossen kehrte er an den Wörthersee zurück. In Krumpendorf bestieg er ein Boot, das ihn zu seiner Villa bringen sollte. Dann, ganz plötzlich, löste sich der Knoten. Mahler schreibt: „Beim ersten Ruderschlag fiel mir das Thema (oder mehr der Rhythmus und die Art) der Einleitung zum 1. Satze ein - und in vier Wochen war der erste, dritte und fünfte Satz fix und fertig!“
Das Gefühl und die Assoziation beim Anhören des ersten Satzes, den Mahler mit „Langsam“ überschreibt, vermitteln allerdings nichts Sommerliches, Helles, Heiteres. Ganz im Gegenteil: aus der eher düsteren Einleitung entwickelt sich ein schreitender Gestus, dem so gar nichts von sommerlichem Spaziergang anhaftet.
Den zweiten und vierten Satz hatte Mahler bereits im Vorjahr abgeschlossen. Anders als der Titel „Nachtwanderung“, den man der 7. Sinfonie gegeben hatte, stammte die Bezeichnung dieser beiden Sätze mit „Nachtmusiken“ vom Komponisten selbst. Und ganz zweifellos markiert sie Mahlers Bezug zur romantischen Epoche, welche die Nacht als eigentlichen Gegenstand der Musik mit Begriffen wie „Dunkelheit“, „Ungewissheit“, „Sehnsucht“ und „Traum“ verband. Alma Mahler schrieb in ihren Erinnerungen: „Ihm schwebten bei den Nachtmusiken Eichendorffsche Visionen vor, plätschernde Brunnen, deutsche Romantik.“
Die zwei „Nachtmusiken“ rahmen den dritten Satz, das Scherzo ein, den Mahler mit der Spielanweisung „schattenhaft“ versehen hatte. Die Musik, die so „schattenhaft“ begann, behält ihren dunklen, unwirklichen Charakter bei, steigert sich aber alsbald zu einem parodistisch ausufernden Walzer. Beide „Nachtmusiken“ sind von ganz unterschiedlichem Charakter. Die erste entwickelt, beginnend mit einem Dialog zweier Hörner zu einem eigentümlichen, zwischen Moll und Dur changierenden Marsch. Der österreichische Musikkritiker und Schriftsteller Richard Specht erlebte bei dieser Musik in Gedanken „den Zug einer geisternden Scharwache, unter längst vergessenen, aus fernen Zeiten klingenden Marschrhythmen und wehmütigen Liedern“. Der 4. Satz, die zweite „Nachtmusik“ hingegen, die mit einem innigen Geigenmotiv beginnt, fällt vor allem durch ihre Instrumentierung auf: Mahler übernahm zwei Instrumente in den Orchesterapparat, die man im romantischen Orchester sonst nicht findet: die Gitarre und die Mandoline. Dafür verzichtet er auf Schlagwerk und Trompeten, Posaunen und Tuba. Stattdessen dominieren Streicher, Hörner und Holzbläser den beinahe liedhaften Charakter des vierten Satzes.
In strahlendem C-Dur dann der Finalsatz, eingeleitet sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten, markiert den krassen Gegensatz: „Durch Nacht zum Licht“, als sollten die nächtlichen dunklen Assoziationen mit aller Macht vertrieben werden. Dass Mahler hierfür eine so überschwängliche musikalische Jubelstimmung inszenierte, brachte ihm nicht nur begeisterte Zustimmung ein. Manchem war sie nicht geheuer, andere sahen darin eine Persiflage auf das „Meistersinger“-Vorspiel Richard Wagners, mithin ein Sakrileg.
Mahlers 7. Sinfonie gehört zu den eher selten gespielten Werken. Umso mehr schwärmte die Kritik anlässlich der beiden Aufführungen im Mai 2018: „Kyrill Petrenko und dem Bayerischen Staatsorchester mit allen großartigen Solisten vom Konzertmeister bis zum Tenorhornisten, glückte jetzt im Nationaltheater eine hinreißende, besonders in den drei nachtschwarzen Mittelsätzen, im wahren Sinne des Wortes eine unheimliche Aufführung“.
Die vorliegende CD als Ergebnis eines Mitschnitts dieser Konzerte macht das auf beeindruckende Weise nachvollziehbar.
tzm