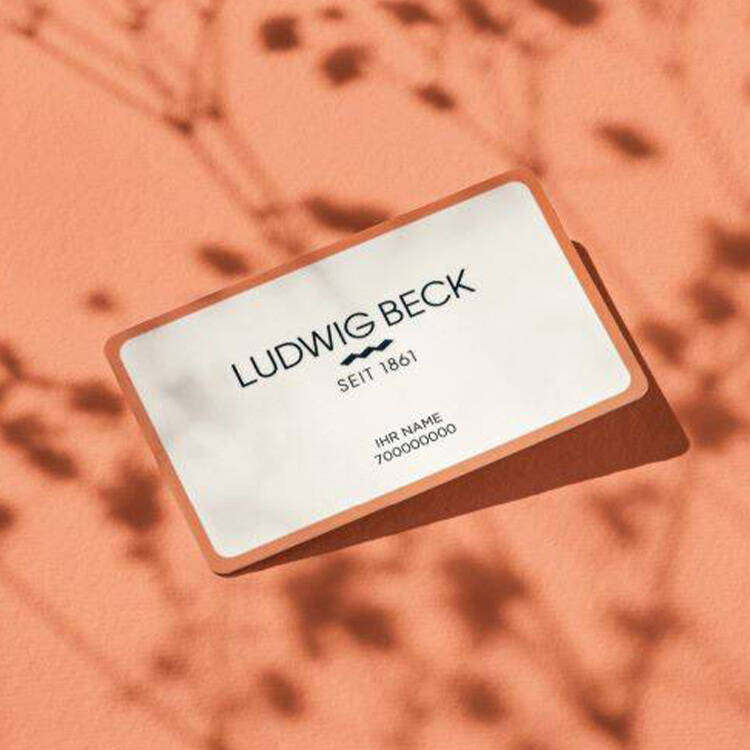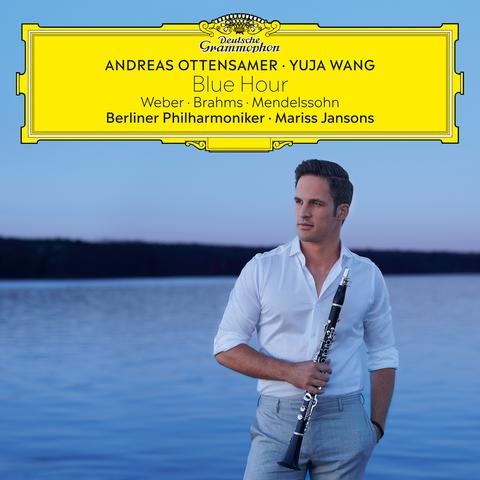
1 CD
Deutsche Grammophon
Die Blaue Stunde der Romantik
Am Abend des 6. Juli 1815 schreibt Carl Maria von Weber an seine spätere Frau Caroline Brandt in einem Brief aus München: „… ich arbeite jetzt eine Sonate für Baermann und mich. Ich möchte dem guten Menschen doch in etwas meinen Dank zeigen…“ Am Vorabend hatte Weber es mit dem Rondo begonnen: das berühmte „Grand Duo concertant pour Pianoforte et Clarinette“ op.48., zwei Wochen später komponierte er das Adagio. Nach weit mehr als einem Jahr, im November 1816, vollendete er das Stück.
Nicht von ungefähr gehörte die Klarinette zu Webers Lieblingsinstrumenten. Die Ursache dafür war zweifellos die Bekanntschaft mit einem Mann, die er 1811 in München machte und aus der eine lebenslange Freundschaft erwuchs. Dieser Mann war der Klarinettist Heinrich Joseph Baermann.
Heinrich Joseph Baermann wurde am 14. Februar 1784 in Potsdam als Sohn eines Militärmusikers geboren - als er am 11. Juni 1847 in München starb, galt er als der bedeutendste deutsche Klarinettist seiner Zeit.
In München bot ihm König Maximilian I. die Stelle eines Ersten Klarinettisten in der Hofkapelle an. Zahlreiche Konzertreisen durch ganz Europa machten ihn über die Maße populär. Er war, als er 1811 dem jungen Carl Maria v. Weber in München begegnete, so etwas wie ein Starmusiker. Die Freundschaft mit Carl Maria von Weber und später mit Felix Mendelssohn wurde für alle Beteiligten zu einer Zeit gemeinsamen Schaffens und gegenseitiger Inspiration. Baermann war ein innovativer Musiker. Seine Klarinette, damals von neuester Bauart, war mit zehn Klappen ausgestattet. Ihr erweiterter Tonumfang und der geschmeidige Klang begeisterten Weber ebenso wie ihre Brillanz und ihre warme Klangfülle. Zudem ermöglichte dieses Instrument es dem Spieler, solistisch höhere und zugleich kompliziertere Anforderungen des Komponisten zu erfüllen. Weber konnte also bei Heinrich Baermann aus dem Vollen schöpfen - kein Wunder dass er ihm all seine Klarinettenkompositionen schrieb, darunter das schon erwähnte Grand Duo Concertant op. 48 und das Klarinettenquintett op. 34. Nachdem sich Weber 1811 in München aufgehalten hatte, entstanden innerhalb nur eines Jahres nacheinander das Concertino für Klarinette und Orchester op. 26., sowie die beiden Klarinettenkonzerte, deren erstes, das Klarinettenkonzert Nr.1 f-Moll, op. 73, Andreas Ottensamer für dieses Album ausgewählt hat.
Auch Felix Mendelssohn Bartholdy war von dem Klarinettenspiel Heinrich Joseph Baermanns so stark beeindruckt, dass er für den Virtuosen die zwei Konzertstücke op.114 komponierte, kleine dreisätzige Konzerte, die ein beredtes Zeugnis für die Kunst der Baermanns sind. Die physische und gefühlte Nähe des Klarinettentons zur menschlichen Stimme kam den Repertoirevorstellungen für dieses Album sehr entgegen: eine Auswahl aus Mendelssohns insgesamt 48 Klavierkompositionen, die unter dem Namen „Lieder ohne Worte“ als fester muskalischer Terminus überliefert haben. Andreas Ottensamer selbst nahm die Auswahl und die Bearbeitungen für Klarinette und Klavier vor. „Mendelssohns Lieder ohne Worte sind so phantastisch pur und direkt – und gleichzeitig hoch romantisch. Diese Musik hat für mich etwas so Intimes, dass ich die Arrangements unbedingt selbst machen wollte“, sagt er selbst dazu.
Ganz ähnlich sein Herangehen an die Bearbeitung des Intermezzos in A-Dur op.118/2 von Johannes Brahms. Auch hier folgt er dem der Komposition innewohnenden melodischen Impetus, während er die Gesangsmelodie des Liedes “Wie Melodien zieht es mir” op. 105 / 1 direkt auf die Klarinette überträgt. Andreas Ottensamer: „Brahms ist für mich der romantische Komponist. Dieser Text ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr blumig, es geht um Blüten, Düfte, um den Hauch – was sich ja wunderbar verbindet mit dem Klarinettenton. Das alles ist natürlich sinnbildlich für eine verlorene Beziehung oder einen melancholischen Gedanken an eine Person, so träumerisch wie die Erinnerungen an ein vergangenes Glück, die einen in der verklärten blauen Stunde – dieser kurzen Zeitspanne zwischen Sonnenuntergang und Heraufziehen der nächtlichen Dunkelheit – bisweilen umfangen halten. Diese Geschichte muss man einbinden in das instrumental gespielte Lied.“
tzm