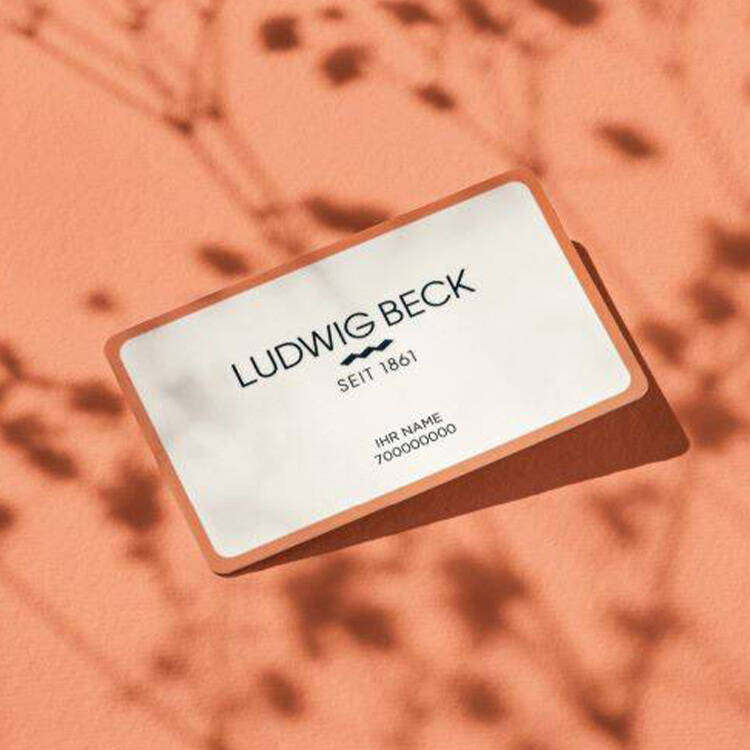Daniel Müller-Schott/ Francesco Piemontesi
„Brahms Cellosonaten“
ORFEO
Brahms Cellosonaten.
Es ist ihre zweite gemeinsame Einspielung. Nach den Cellosonaten von Schostakowtisch, Prokofiev und Britten legen Daniel Müller-Schott und Francesco Piemontesi nun ein reines Brahms-Album mit beiden Cellosonaten in e-Moll, op.38 und F-Dur, op. 99 sowie der erste der drei Violinsonate in G-Dur op.78 vor, die hier in einer Bearbeitung für das Cello in D-Dur erklingt. Johannes Brahms selber nannte die hinreißend schöne Sonate ein „doppeltes Lenzlied, welches „die Vergangenheit mit der Gegenwart wieder zum Blühen bringt und dabei an die Hinfälligkeit der Zeiten mahnt“. Entstanden war sie im Mai 1878 auf der Rückkehr von seiner ersten Italienreise in Pörtschach am Wörthersee. Ihren Beinamen „Regenlied-Sonate“ verdankt sie dem Umstand, dass der 3. Satz mit dem Zitat des „Regenliedes“ beginnt, das Brahms fünf Jahre zuvor für Clara Schumann als Trost für den unheilbar erkrankten Sohn Felix komponiert hatte.
Den Rahmen der Einspielung bilden die beiden Cellosonaten, die in einem auffallend deutlichen Unterschied zueinanderstehen und zugleich das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit den beiden Sonaten Beethovens sind. In den 1860er Jahren hatte Brahms sich ausführlich mit dem Werk Ludwig van Beethovens beschäftigt.
Zwischen der Entstehung der beiden Werke liegt indes ein Zeitraum von über zwanzig Jahren. Für seine erste Cellosonate e-Moll, op.38, an der er fast drei Jahre (1862 bis 1865) arbeitete und die erst 1871 uraufgeführt wurde, hatte Brahms ursprünglich vier Sätze vorgesehen. Allein, vor der Veröffentlichung strich Brahms den langsamen Satz wieder heraus und war trotz engagierten Zuredens von Clara Schumann nicht zu bewegen, das Werk viersätzig herauszugeben. Seine zweite Cellosonate in F-Dur op.99 entstand auf Anregung des mit Brahms befreundeten Cellisten Robert Hausmann in relativ kurzer Zeit, im Sommer 1886 im schweizerischen Thun. Hausmann, Cellist im Streichquartett Joseph Joachims, bestritt die Uraufführung der Sonate im November 1886 auch gemeinsam mit dem Komponisten. Brahms hatte seine zweite Cellosonate in einem Schaffensrausch gemeinsam mit der Violinsonate A-Dur, op. 100 und dem Klaviertrio c-Moll, op. 101 komponiert.
Sie weist im Unterschied zur ersten Sonate nicht nur vier Sätze auf – sie ist auch, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, eines der anspruchsvollsten Stücke für Cello und Klavier.
tzm