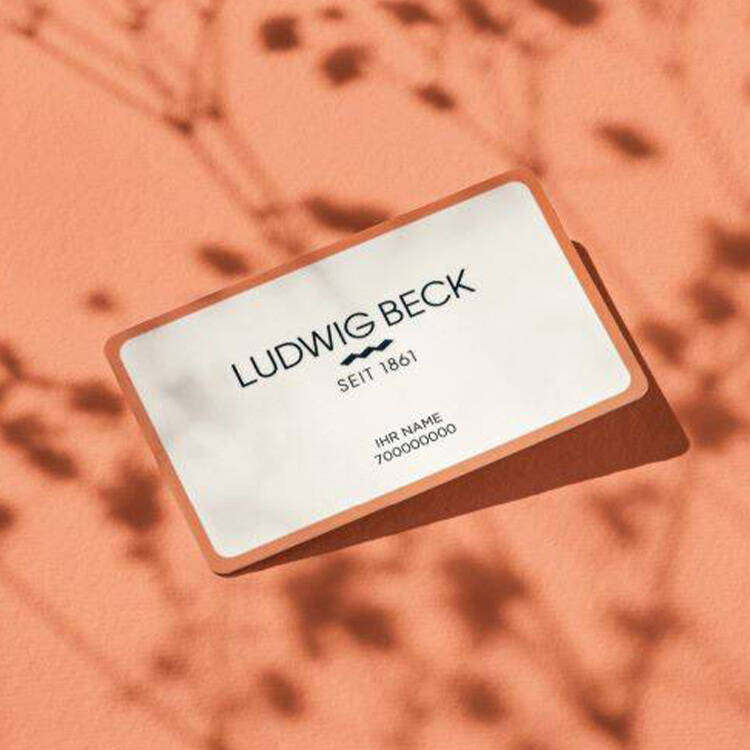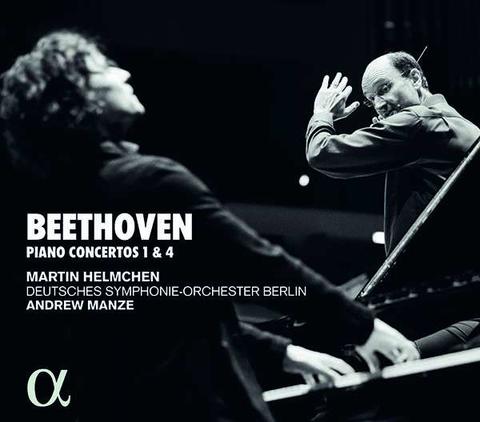
Helmchen/Manze/Deutsches Symphonie-Orch. Berlin
„Klavierkonzerte 1 & 4“
alpha
Klavierkonzerte 1 & 4.
Beethoven hatte seine ersten beiden Klavierkonzerte mehr oder weniger für den eigenen Gebrauch geschrieben. Noch ganz im Banne der späten Mozartschen Kompositionen begann jedoch schon mit der Arbeit an seinen beiden ersten Klavierkonzerten in B-Dur, op. 19 und in C-Dur, op. 15 der Prozess des Abnabelns von den Vorbildern der Wiener Klassik. Die Komposition des C-Dur-Konzerts, eigentlich Beethovens Zweites, hatte letztlich sechs Jahre in Anspruch genommen, die Drucklegung erfolgte 1801 - viel später erst schrieb er die Kadenzen zu diesem Konzert.
Der Komponist hatte bei der Uraufführung am 2. April 1800 in Wien den Klavierpart selbst gespielt. Ebenso trat Beethoven auch als Solist bei der öffentlichen Uraufführung des Klavierkonzerts Nr. 4 in G-Dur , op. 58 im Rahmen einer „Akademie“ im Dezember 1808 in Wien auf. Welch gewaltiger musikalischer Fortschritt hatte sich im Laufe dieser sieben Jahre bei Ludwig van Beethoven vollzogen! Allein der Programmzettel dieser „Akademie“ markiert die enorme Entwicklung des Komponisten. Die 5. und 6. Sinfonie, Teile der „Missa solemnis“ und die „Chorfantasie“ – selbstverständlich, dass ein Vergleich des ersten mit dem vierten Klavierkonzert diese Entwicklung deutlich macht. Die früheste Skizze eines Konzepts für den ersten Satz findet sich im Skizzenbuch für die „Eroica“. Beethoven allerdings verschob die Arbeit an dem Konzert bis nach der „Leonore“ 1805. Ein Jahr später schickte er seinen Neffen Karl mit den Klavierauszügen von „Leonore“, dem Oratorium „Christus am Ölberge“ und „einem neuen Klawier Konzert...“ zu seinen Leipziger Verlegern Breitkopf & Härtel. Und schon der nachdenkliche, ruhige Beginn des Konzerts, den der Solist für wenige Takte allein bestreitet, artikuliert die Rolle, die Beethoven dem Solisten mit seinem souveränen, „wissenden“ Spiel zuschreibt. Dazu zählt auch - und vor allem - die Gestaltung des zweiten Satzes, der in seiner Schroffheit der Gegensätze kaum zu überbieten ist. Die dramatischen Einwände des Orchesters, denen ein unfassbar ruhiges und lyrisches Besinnen des Klaviers entgegensteht, mit der besonderen Herausforderung endloser gleichmäßiger und doch nie langweilig werdender Triller.
Es erweist sich als vortrefflich, dass der Geiger und Dirigent Andrew Manze von der historisch informierten Spielweise beeinflusst ist – so zeigt sich diese Einspielung fern jeglicher „Interpretationen“ was Dynamik, Tempi und Tongebung angeht. Der Pianist Martin Helmchen, das Deutsche Sinfonieorchester Berlin und Andrew Manze sind in der Phrasierung ganz auf einer Linie.
tzm