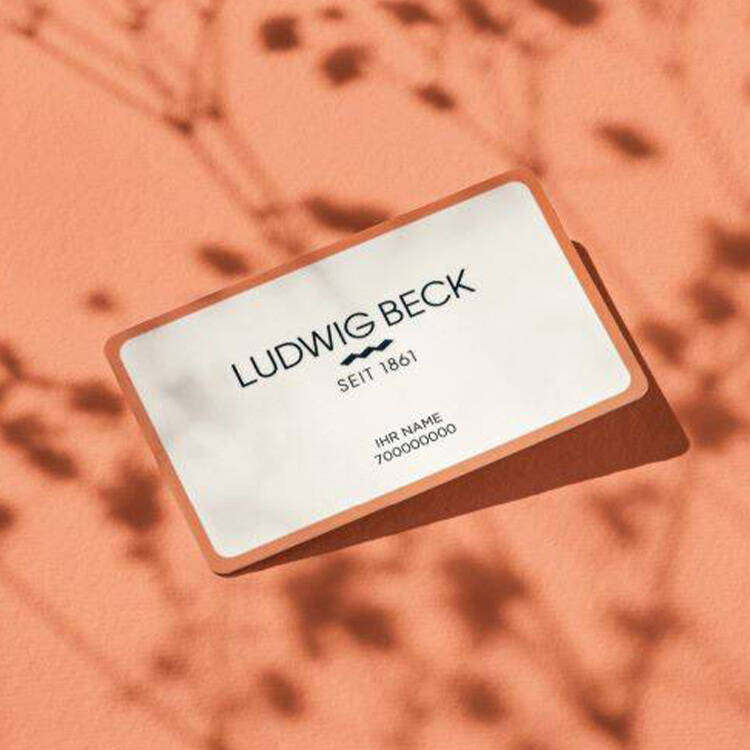„J.S.Bach: Die Geheimnisse der Harmonie – eine Hörbiografie von Jörg Handstein“
Das spärlich dokumentierte Leben Johann Sebastian Bachs lässt Romanen viel Raum für die Fantasie. Gut erzählt, bieten jedoch auch die authentischen Quellen eine fesselnde Geschichte: Sohn eines Stadtpfeifers, Organist, Konzertmeister, Kapellmeister, dann 27 Jahre Thomaskantor in Leipzig. Zweimal verheiratet, 20 Kinder. Wirkungsraum Thüringen und Sachsen. Verglichen mit der spektakulären Biografie Händels scheint dieser Lebenslauf eher unauffällig.
Aber auch Bachs Biografie verschafft einen faszinierenden Einblick in eine uns sehr ferne und fremde Zeit. Da sind die stolzen, aufstrebenden Städte, und da sind die prächtigen Höfe. Beschränkte Stadtväter und musikliebende, aber unberechenbare Fürsten. Schon etwas altbackene Kirchenmusik und die angesagte Instrumentalmusik aus Frankreich und Italien. Bach bewegt sich souverän im Spannungsfeld dieser gegensätzlichen Welten und erschafft dabei eine Musik, die an Kunstfertigkeit, Tiefe und Ausdruckskraft, diejenige all seiner Zeitgenossen übertrifft. In Leipzig will er die Kirchenmusik auf ein völlig neues Niveau heben, auf Augenhöhe mit der Theologie, vielschichtig und direkt zu den Gläubigen sprechend. Doch nach wenigen Jahren schwindet sein Elan. Von Natur aus eigensinnig und kompromisslos, wird er jetzt unruhig und unzufrieden, reibt sich auf im Kampf mit den kleinlichen Behörden. Er macht wieder viel weltliche Musik, sucht den Kontakt zum Dresdner Hof und zieht sich schließlich in seine ganz eigene Welt zurück, um die letzten „Geheimnisse der Harmonie“ zu ergründen.
Die Hörbiografie kommt dem Protagonisten so nahe, wie es die Quellen erlauben, und auch sein Umfeld – Fürsten, Kirchenmänner und Stadträte, Freunde und Widersacher – erwacht zum Leben. Auch die oft kuriose Alltagswelt des 18. Jahrhunderts wird ausgeleuchtet: die nicht immer erbaulichen Gottesdienste, die schlimmen Verkehrsmittel, das üppige Tafeln und Trinken, die Schrecken einer Augenoperation.
Im Mittelpunkt aber steht die Musik. „Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen“, soll Beethoven gesagt haben, „wegen seines unendlichen unausschöpfbaren Reichthums von Toncombinationen und Harmonien.“ Die zahlreichen und dicht mit der Erzählung verwobenen Musikbeispiele lassen den Hörer förmlich eintauchen in diese unermessliche Fülle.
Udo Wachtveitl ist nicht nur Tatort-Kommissar, sondern auch Musikliebhaber und langjähriger Erzähler der BR-Hörbiografien. Ihm ist die „Struktur hinter Musik“ sehr wichtig, und demgemäß inspirierte ihn Bachs Leben und Schaffen ganz besonders. Neben dem aus Jena gebürtigen und derzeit hochgeschätzten Schauspieler Albrecht Schuch („Im Westen nichts Neues“) als Johann Sebastian Bach glänzen auch herausragende Sprecher des BR in den verschiedensten Rollen. Ein vielstimmiges Hörvergnügen!
BR-KLASSIK
Das ist ein anderer Atem…
Ein Interview mit dem Schauspieler Albrecht Schuch
Von Thomas Otto
Er dürfte zu den meistbeschäftigten deutschen Schauspielern der Gegenwart zählen: der 1985 in Jena geborene Albrecht Schuch. Aus der Vielzahl seiner Filme seien nur einige genannt. In „Die Vermessung der Welt“ (2012) nach dem Roman von Daniel Kehlmann ist Schuch als Alexander von Humboldt zu sehen, in „Systemsprenger“ (2017) als Anti-Aggressionstrainer Micha, der mit straffälligen Jugendlichen arbeitet. „Lieber Thomas“ (2021) ist ein Film über Thomas Brasch, der sich in der DDR als Schriftsteller verwirklichen will und dabei sein Potenzial als poetischer Rebell entdeckt mit Albrecht Schuch in der Titelrolle. Der Antikriegsfilm Film „Im Westen nichts Neues“(2022) nach dem Roman Erich Maria Remarque – Schuch verkörpert hier den Soldaten Stanislaus “Kat” Katczinsky - hat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gleich vier Trophäen abgeräumt.
Für die Hörbiografie über Johann Sebastian Bach von Jörg Handstein, die jetzt bei BR-Klassik erscheint, übernahm Albrecht Schuch die Titelrolle. Auf dem Weg zur Oscar-Verleihung nach Los Angeles fand er Zeit für das folgende Gespräch mit dem Musikjournalisten Thomas Otto über diese Produktion.
Thomas Otto: Ihre Schauspielausbildung absolvierten Sie an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) "Felix Mendelsohn Bartholdy" in Leipzig, also quasi bei Bach um die Ecke – bis zur Thomaskirche sind es knappe 500 Meter. Haben Sie ab und zu mal „angeklopft“, oder ist die Produktion dieser Hörbiografie Ihre erste Begegnung mit Bach?
Albrecht Schuch: Definitiv nicht, die liegt viel früher zurück. Wir haben in der Kindheit, da war ich etwa vier Jahre alt, sehr oft das „Weihnachtsoratorium“ gehört. Später habe ich meinem kleineren Bruder immer was vorgespielt, wenn er einschlafen sollte – mein Vater hatte da so eine bestimmte Platte. Mit Zwölf war ich für zwei Jahre im Jugendchor der Jenaer Philharmonie, da gab es eine erneute Begegnung mit dem „Weihnachtsoratorium“ und anderen Stücken von Bach, an die ich mich jetzt aber nicht mehr erinnere. Natürlich habe ich in meiner Leipziger Zeit den Thomanerchor gehört, da kam man gar nicht dran vorbei. Wir hatten in der Thomaskirche auch mal gedreht. Sie war dann für mich so ein Rückzugsort, um Texte zu lernen. Und oft hat in dieser Zeit jemand an der Orgel gesessen und Bach geübt. Ich habe das nicht bewusst aufgesucht - ich finde Orgelmusik muss man in der Kirche hören, nicht zu Hause auf der Schallplatte. Das ist wie mit dem Film, den man im Kino sehen muss und nicht auf dem Fernsehbildschirm.
Haben Sie mal ein Instrument gelernt, Klavier zum Beispiel?
Nein, Schlagzeug.
Auf Ihre Filmrollen bereiten Sie sich akribisch vor, konsultieren Menschen, die Ihnen im Hinblick auf die darzustellenden Charaktere ein bestimmtes Wissen oder auch ein Feeling vermitteln können. Gab es einen solchen Prozess auch in Vorbereitung auf dieses Projekt? Immerhin waren Sie, anders als im Theater oder beim Film, auf Ihre Stimme „reduziert“…
Ich habe den Text ein paarmal gelesen und das war alles. Ich fand es spannend, mich in dieser Situation mit dem Regisseur auseinandersetzen zu können. Das war ja, was das Hörspiel angeht, erst meine zweite Arbeit. Da lerne ich erst mal Text ohne mich mit dem Drumherum „zuzudecken“. Mir war zunächst wichtig, dass ich den Text verstehe, auch wenn mir das musiktheoretische Wissen fehlt.
Wir haben zum Beispiel sehr viel an dem Maß des Dialekts gearbeitet, an der Saloppheit der Sprache Bachs, dieser fast punkigen Art. Das war für mich eine ganz neue Seite, die ich an ihm nicht kannte.
Sie selbst sind in Thüringen geboren. Auch Bach verbachte fast die Hälfte seines Lebens dort: in Eisenach kam er zur Welt, in Ohrdruf ging er zur Schule. In Arnstadt verliebte er sich in seine spätere Frau Maria Barbara und in Mühlhausen entstand seine erste überlieferte Kantate. In Weimar schließlich stieg er nicht nur vom Organisten zum Konzertmeister am Hof des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar auf – hier kamen auch sieben seiner Kinder zur Welt. Sind solche biographischen Aspekte wichtig für Ihre Arbeit im Tonstudio?
Ja, es ist wichtig, diese Umstände zu wissen. In diesem besonderen Fall war es einfach schön, dass man mal im Dialekt arbeiten durfte. Das ist ein Dialekt, der mir vertraut ist, der damals aber auch noch mal anders und stärker vorhanden war. Ich spreche ja irgendwie so ein Gemisch aus dem Jena 90er Jahre und der Gegenwart. Das ist der Dialekt, den ich kenne, mit dem ich aufgewachsen bin, der auch durch meine Mutter, die aus Dresden stammt, leichte sächsische Einflüsse hat. Also ich gehe damit nicht streng dokumentarisch um. Wenn man das versuchen wollte, ich wüsste gar nicht, wie man das hinbekommen wollte. Aber wenn das jetzt ein Text über Bayern wäre, dann müsste ich mich darauf ganz anders vorbereiten.
Goethe hat, glaube ich, mal gesagt, dass der Dialekt der direkteste Weg zum Herzen sei. Es sind die besonderen Töne und - um mal bei der Musik zu bleiben – die Melodien, die damit in der Sprache einhergehen, die einzelnen Worte, die Pausen, die Betonungen. All das kreiert schon mal einen gewissen Charakter. Und man muss dabei nicht mal alles verstehen. Ich finde, das ist so ähnlich wie der Micky-Mouse-Heft-Effekt von damals: man musste nicht alle Sprechblasen verstehen und hatte trotzdem einen Eindruck, von dem, was da vor sich ging.
Fällt Ihnen, der Sie sonst auf der Bühne oder vor der Kamera im Sinne des Wortes „sichtbar“ agieren schwerer oder leichter, sich im Tonstudio auf das gesprochene Wort „beschränken“ zu müssen?
Es ist einfacher, wenn man mit anderen Kollegen zusammen im Studio ist, wo man sich die Bälle zuspielen kann. So wie das etwa beim Nachsynchronisieren von Filmen war – da kamen ja auch immer noch mal alle Beteiligten zusammen. Leider wird das heute nicht mehr gemacht. Schwieriger ist es tatsächlich, wenn ich, so wie bei dieser Bach-Produktion, allein im Studio sitze, weil man da nicht, wie sonst, den Ton des Partners oder der Partnerin abnehmen und darauf reagieren kann. Das ist ein anderer Atem…
Welches Bild von Johann Sebastian Bach hatten Sie vor der Produktion? Hat es sich weiterentwickelt, verändert?
Ich hatte von der Person Johann Sebastian Bachs eigentlich gar keine Vorstellung. Das Bild von ihm bekam ich erst mit der Produktion dieser Hörbiografie. Und was immer passiert, egal, ob bei so einer Arbeit oder beim Film: das falsche Glorifizieren, auf den Sockel stellen oder im Umkehrschluss das Verteufeln der Person, die man darstellt, fällt mit der Arbeit weg, weil der Mensch hinter dieser Rolle mit all seinen Talenten und Fehlern immer sichtbarer wird. Es wird nicht mehr so überbordend falsch, wie das oft so ist bei bekannten und prominenten Persönlichkeiten, die irgendwas Großes oder Krasses getan haben, gut oder schlecht, böse oder fein. Mir ging das häufig so bei Begegnungen mit Rollen solcher Persönlichkeiten: zunächst war da oft ein falscher Respekt vorhanden oder eine Überglorifizierung vorhanden. Und es ist immer wieder erstaunlich und erleichternd zugleich, zu erleben, dass das einfach auch nur Menschen waren.
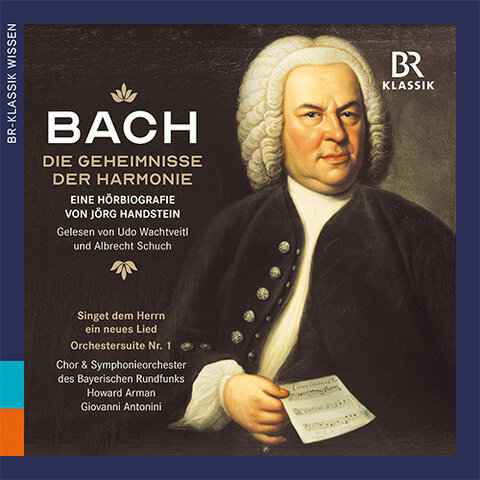
„J.S.Bach: Die Geheimnisse der Harmonie – eine Hörbiografie von Jörg Handstein“
BR-KLASSIK
4CD – 25,95 €