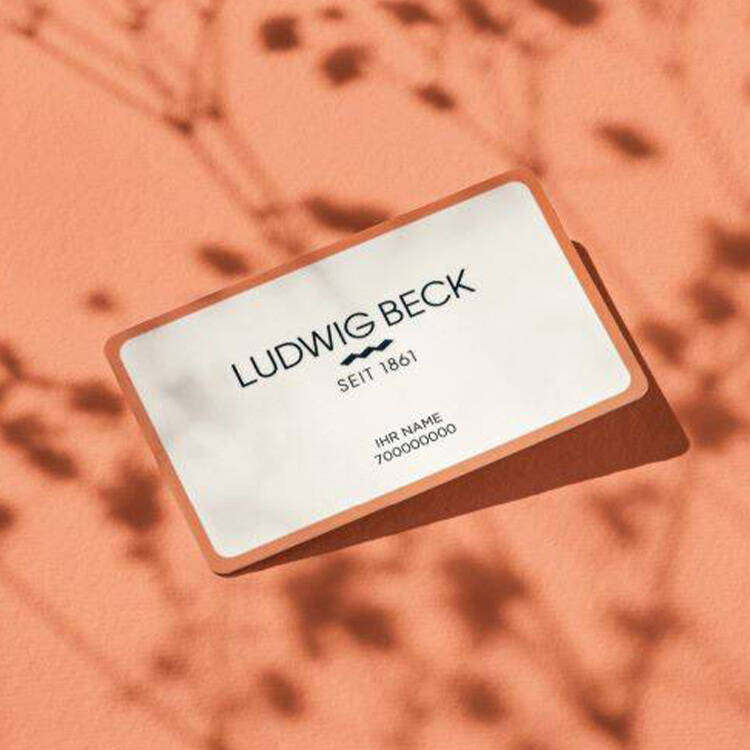1 CD
Sony Classical
Schubert
Den Schwerpunkt ihres neuen Albums, auf dem sich die Pianistin Kathia Buniatishvili ganz dem Komponisten Franz Schubert widmet, bildet dessen Klaviersonate B-Dur D 960, ein Werk, dessen Interpretationen durch große Pianisten aller Zeiten immer wieder aufhorchen lassen, so wie auch die vorliegende es zweifellos tun wird.
Die „Wiener Zeitschrift für Kunst usw.“ veröffentlichte am 8. Januar 1828 ein zehnstrophiges Gedicht Eduards von Bauernfeld, einem engen Freund Franz Schuberts: „Am Silvester-Abend 1827“.
Der Zauber der Rede, der Quell der Gesänge-
Auch er vertrocknet, so göttlich er ist;
Nicht rauschen die Lieder, wie sonst im Gedränge,
denn auch dem Sänger ward seine Frist: -
die Quelle eilet zum Meere wieder,
der Liedersänger zum Quelle der Lieder.
Ob Franz Schubert dieses Gedicht gelesen hat ist nicht überliefert, obwohl man bei dem regen Gedankenaustausch innerhalb von Schuberts Freundeskreises davon ausgehen kann. Gleichwohl ist es von prophetischem Charakter. Im Jahre 1828 stirbt Franz Schubert mit gerade mal 31 Jahren. Zuvor jedoch komponiert er u.a. die Große C-Dur-Sinfonie D 944, die Messe in Es-Dur D 950, das Streichquintett D956. Im September 1828, vollendet er eine Folge von drei großen Klaviersonaten, darunter seine letzte, jene in Es-Dur D 960. Die Vielzahl von angefangenen, nicht weitergeführten Fragmenten belegt Schuberts ständige Suche nach der großen Form – in der großen C-Dur-Sinfonie hatte er sie gefunden. Bei Klaviersonaten hingegen lag die Messlatte besonders hoch – durch Beethovens bis dato geschaffenen Höhepunkt dieses klassischen Genres. Mit seinen letzten drei 1828 komponierten Sonaten nun stellte sich Schubert dem Vergleich.
Die Sonate in B-Dur D 960, ist nicht nur sein letztes Klavierstück, sondern auch das letzte Stück Instrumentalmusik. Hernach folgte nur noch eine Hymne für Männerstimmen mit Instrumentalbegleitung. Nicht von ungefähr ist bei der B-Dur-Sonate von einem „Schwanengesang“ die Rede, von Abschied, von Resignation. Allerdings weisen erhalten gebliebene Skizzen daraufhin, dass die Beschäftigung Schuberts mit seinen drei letzten Sonaten länger andauerte und weit vor dem September 1828 begann. Das latente Gefühl einer Auseinandersetzung mit Tod und Trauer, das sich besonders aus dem ersten beiden Sätzen der B-Dur-Sonate herstellt, ist nicht unmittelbar mit Schuberts eigenen Schicksal verknüpft. „Schwanengesang“ also eher als eine Art „Abschied besonderen Charakters“? In der Tat unterscheidet sich die B-Dur-Sonate in ihrem Charakter allerdings sehr von den anderen beiden der Trias.
Nicht erst der zweite Satz, das Andante Sostenuto, wie entrückt, kaum greifbar, sphärischen Charakters führt den Hörer aus der Welt - schon der erste Satz im Molto Moderato entschleunigt und sensibilisiert ihn für ein Innehalten. Auffälliges und rätselhaftes Moment dieses sehr langen Eingangssatzes ist der tiefe Triller am Beginn der Einleitung, wie ein Trommeln, ein Warnen vor etwas Ungewissem. Um so mehr wäre, folgte man der Logik der bisherigen Formensprache, der nachfolgende zweite Satz als Kontrast zum ersten zu erwarten gewesen, stattdessen treibt Schubert im Andante Sostenuto die Langsamkeit auf die Spitze. Selbst der vergleichsweise kurze dritte Satz, ein tänzerisches Scherzo, trägt die Spielanweisung „con delicatezza“ – „mit Zartheit“. Das Eingangsthema des Finales gibt sich heiter verspielt, ganz im Haydn’schen Sinne, aber erst, nachdem, einem Stolperstein gleich, ein einzelnes „G“ als stehender Ton verhallt. Robert Schumann beschrieb es: „Als könne es gar kein Ende haben ... Wohlgemut und leicht und freundlich schließt er dann auch, als könne er Tages darauf wieder von neuem beginnen“. Er konnte nicht – wenige Wochen nach der Vollendung seiner letzten Sonate starb Franz Schubert am 19. November 1828.
tzm