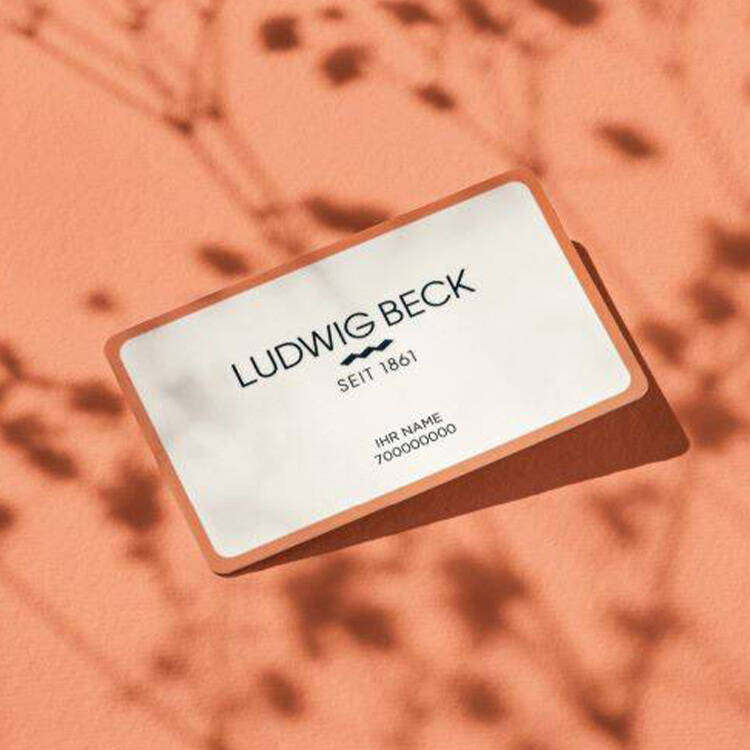"His Last Concert"
BR-KLASSIK
His Last Concert Live at Carnegie Hall.
Dieser Abend in der New Yorker Carnegie Hall war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ein Parcours der Emotionen für alle Beteiligten. (Lesen Sie hierzu das Interview, das Thomas Otto mit dem Konzertmeister des Orchesters Anton Barakhovsky führte.) Vor allem war das natürlich den besonderen Umständen geschuldet, unter denen dieses Konzert stattfand, durchaus aber auch dem Programm, mit dem Mariss Janson aufwartete.
Angefangen mit Richard Strauss.. Der hatte, vier Jahre nach der Fertigstellung seiner Oper „Die Frau ohne Schatten“ das Bedürfnis nach einem heiteren, leichten Stoff, dessen Sujet in seiner eigenen Biografie lag: eine Verwechslungskomödie im privaten Umfeld des Hofkapellmeisters Storch. (Man beachte die Namensähnlichkeit des Komponisten zu seinem Protagonisten.) Das Werk, eine „Bürgerliche Komödie mit vier symphonischen Zwischenspielen“ sei, schrieb Strauss in einem Vorwort, „aus dem realen Leben“ geschöpft, „von nüchternster Alltagsprosa durch mancherlei Dialogfarben bis zum gefühlvollen Gesang“ sich steigernd - Strauss selbst hatte auch das Libretto geschrieben
Einen ganz besonderen musikalischen Stellenwert in diesem Stück erfahren eben jene „Vier symphonischen Zwischenspiele“. Ihre genauen einzelnen Bezeichnungen markieren nicht nur den Verlauf der Oper. Außergewöhnlich breit angelegt, wie etwa das erste („Reisefieber und Walzerszene“) und zweite („Träumerei am Kamin“), kommen alle vier als eigenständige musikalische Musikwerke in dem zumeist rezitativhaft komponierten Lustspiel daher: schwelgerisch, verträumt, heiter.
Im Kontrast dazu die 4. Sinfonie op. 98 in e-Moll von Johannes Brahms. Als der sich endlich entschloss, das Thema „Sinfonie“ in Angriff zu nehmen, fühlte er im Rücken ständig die „Schritte des Riesen Beethoven“, der mit seiner neunten Sinfonie die Gattung an eine Grenze geführt hatte, die unüberwindlich schien. Mehr als 50 Jahre sollte es dauern, ehe Brahms’ 1. Sinfonie in e-Moll am 4. November 1876 in Karlsruhe uraufgeführt wurde. Vor diesem Hintergrund erst ist die Geheimniskrämerei und Verschlossenheit zu verstehen, die Brahms pflegte, wenn es um den Stand seiner Arbeiten ging, auch und besonders bei seiner 4. Sinfonie. Er war knauserig mit Auskünften darüber und gerade seinen Freunden gegenüber hielt er sich bedeckt. Erst im Sommer 1885 schrieb er an Elisabeth von Herzogenberg: „… Dürfte ich Ihnen etwa das Stück eines Stückes von mir schicken und hätten Sie Zeit, es anzusehen und ein Wort zu sagen? … Wenn Ihnen das Ding nicht schmeckt, so genieren Sie sich nicht. Ich bin gar nicht begierig, eine schlechte Nr. 4 zu schreiben.“
Die Arbeit an der e-Moll-Sinfonie, seiner letzten großen sinfonischen Arbeit, zog sich über zwei Jahre, besser gesagt über zwei Sommer in den Jahren 1884 und 1885 hin. 1984 entstanden die ersten beiden Sätze. Dann blieb das Material ein Jahr lang liegen und erst im Sommer 1885 komponierte Brahms die anderen beiden - zunächst den vierten, dann den dritten! Bei allem Understatement, das Brahms in Bezug auf seine 4. Sinfonie pflegte - bei der Veröffentlichung seines neuen Opus durch seinen Verleger Simrock wollte er nichts dem Zufall überlassen - und schon gar nicht bei der Uraufführung. Johannes Brahms war in der komfortablen Situation, seinen Neuling mit der Meininger Hofkapelle, einem damaligen Spitzenorchester, einstudieren zu können. Ihm zur Seite stand ein hochmotivierter und überaus fähiger Orchesterleiter, der zugleich sein Freund war: Hans von Bülow. So konnte Brahms bestimmte Wirkungen praktisch probieren, konnte sie sinnlich erfahren und, wo nötig, Änderungen vornehmen.
Brahms war nach dem Abschluss der Arbeiten an seiner Sinfonie unentschlossen. Im schien es auf einmal nötig, dem bereits fertigen 1. Satz eine viertaktige Einleitung durch die Bläser voranzustellen, quasi ein Eröffnungsmotiv. Kurz bevor er das Manuskript jedoch in Druck gab, strich er sie wieder aus. Die Datierung dieses Vorgangs legt nahe, dass Brahms seine Entscheidung bei den eben erwähnten Proben mit der Meininger Hofkapelle getroffen hat. Brahms, der Pragmatiker! Und so beginnt dieser Satz mit einem Seufzen – der Suche nach einer Formulierung zur Beschreibung des Seelenzustandes gleich – in e-Moll.
Um so größer der Kontrast zum zweiten Satz in der Tonart E-Dur. Seine eigentümliche Wirkung bezieht der zweite Satz aus der Besinnung Brahms’ auf die alten Kirchentonarten: hier ist es die phrygische Skala, die das Hauptthema charakterisiert, gleich von Anfang an und die ihm etwas Geheimnisvolles verleiht. Dem dritten Satz haftet Burleskes an. Die Attribute seiner Beschreibung reichen von „wild und dämonisch“ über „lärmend“ bis zu „graziös rokokkohaft“. Dazu werden seine musikalischen Gedanken einer extremen dynamischen Spannweite ausgesetzt: starke Crescendi und Decrescendi vom Pianissimo bis zum Fortissimo. „Allegro energico e passionato“ schließlich ist der vierte Satz bezeichnet: energisch und leidenschaftlich. Doch statt des eines erhellenden Abschlusses endet die Sinfonie wie sie begann: in e-Moll und lässt den Zuhörer am Ende, aufgewühlt aber irgendwie ratlos zurück.
tzm