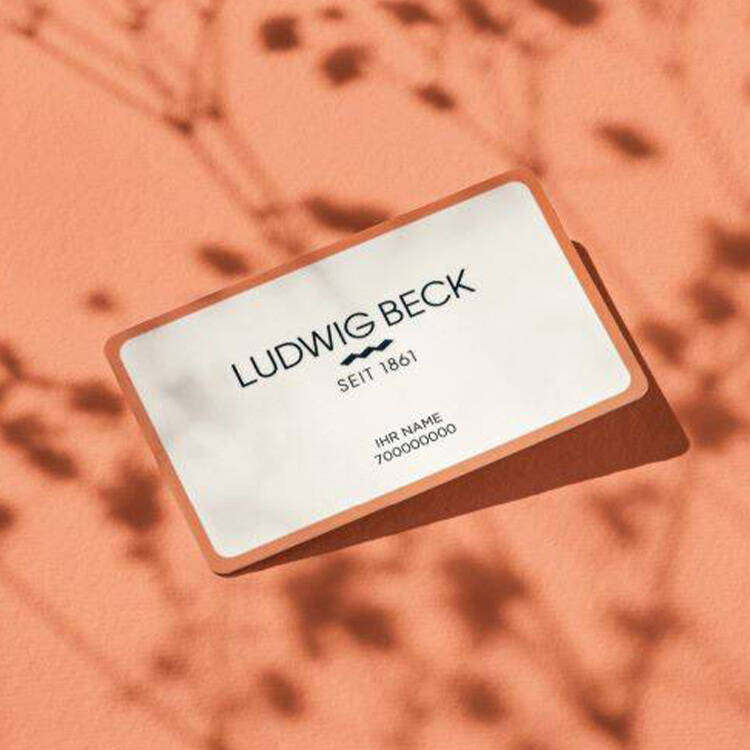"Romantic Cello Concertos"
Sony Classical
Die Cellistin Raphaela Gromes wartet auf ihrem neuen Album mit einer überraschenden Weltersteinspielung auf: dem 3. Cellokonzert in a-Moll, op. 31 von Julius Klengel. 1859 geboren spielte der bereits als 15jähriger im Gewandhausorchester und tourte mit Sechszehn als „Wundercellist“ durch Deutschland. Der Zeitgenosse von Johannes Brahms und Richard Strauss hat neben seinen zahllosen Konzertverpflichtungen und seiner Professur als Cellolehrer am Leipziger Konservatorium auch zahlreiche Werken für Cello komponiert, darunter vier Konzerte für Cello und Orchester, von denen zwei, das erste und das vierte, bereits eingespielt wurden. Das bislang unveröffentlichte Cello-Konzert Nr. 3 in a-Moll aber erschien erst jetzt im renommierten Notenverlag Boosey & Hawks. Dessen romantischer Charakter, erkennbar schon in der dunklen und dramatischen Orchestereinleitung, wird vor allem durch „schwelgerischen Melodien mit geradezu mendelssohnscher Leichtigkeit“, wie Raphaela Gromes sie beschreibt, geprägt. Originell auch der zweite Satz, der mit einem sich wiederholenden Fanfarenmotiv den Dialog zwischen Orchester und Cello geradezu herausfordert – es wird auch in der virtuosen und zugleich innigen Kadenz immer wieder zitiert. Das zu Unrecht bisher vernachlässigte Werk endet schließlich in einem fulminanten Finale.
Julius Klengel selbst hatte am 21. Januar 1892 den Solopart bei der Uraufführung durch das Gewandhausorchester gespielt. Der Komponist Gustav Schlemüller schrieb damals über dieses Konzert im Leipziger Anzeiger, dass das Werk „als eine wirkliche Bereicherung der einschlägigen Literatur zu betrachten“ sei, weil es sich „überall von Trivialitäten fernhält und in der Cantilene sowohl im Passagenwerk eigenartig ist“.
Cellomusik der Romantik – selbstredend gehört neben der Romanze für Cello und Orchester von Richard Strauss, auch und vor allen Dingen das große a-Moll-Konzert Robert Schumanns dazu. Dessen Tagebucheintrag vom 24. Oktober 1850 lautet: „Abends 1stes Concert – Freude – Das Celloconcert beendigt.“ Einen Monat zuvor war Schumann mit seiner Familie von der Elbe an den Rhein gezogen, wo er von Ferdinand Hiller das Amt des Direktors des Städtischen Musikvereins übernahm. Nach der glücklosen Zeit in Sachsen schien hier in Düsseldorf eine neue Zeit angebrochen. Überwältigt von dem freundlichen Empfang am Rhein hatte sich Robert Schumann in die Arbeit an seinem Cellokonzert in a-Moll op. 129 gestürzt und es im Verlaufe von nur einer Woche skizziert. Clara Schumann, die es „besonders so recht im Cellocharakter geschrieben“ fand, notierte ein Jahr später in ihrem Tagebuch: „... Die Romantik, der Schwung, die Frische und der Humor, dabei die höchst interessante Verwebung zwische Cello und Orchester ist wirklich ganz hinreißend... von welchem Wohlklang und tiefer Empfindung sind alle Gesangsstellen darin!“
Der ursprüngliche Titel „Concertstück“ geht auf Schumanns Neuerungen zurück. So gehen die drei Sätze ohne Pause attaca ineinander über. Die übliche Orchestereinleitung entfällt – nach nur drei Akkorden setzt schon das Cello mit dem Thema ein. Der langsame zweite Satz entsteht förmlich aus dem Orchestertutti am Schluss des ersten Satzes heraus. Seine Hauptthemen werden nicht vom Soloinstrument, sondern dem Orchester übernommen, das sonst nur sparsam zur Geltung kommt. Am Ende des dritten, virtuosen Satzes schließlich erstrahlt das in a-Moll begonnene Konzert in schönstem A-Dur. Nach langer Zeit der Irritation und Zurückhaltung von Musikern und Verlagen bei der Verbreitung dieses Konzerts - die Uraufführung erfolgte, wie auch bei seinem Violinkonzert erst lange nach Schumanns Tod - hat es sich inzwischen den ihm zustehenden Platz in der Geschichte der romantischen Cellokonzerte gesichert. Heute gilt es als das bedeutendste unter ihnen.
Raphaela Gromes hat beide Konzerte zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Nicholas Carter aufgenommen. Drei Miniaturen, die sie mit ihrem langjährigen Klavierpartner Julian Riem quasi als Zugabe musiziert, ergänzen dies Album aufs Feinste: Schumanns „Widmung“ aus dem Liederzyklus „Myrthen“, den Ungarischen Tanz von Johannes Brahms Nr.5 und eine Romanze aus dem Klavierkonzert in a-Moll op. 7, dem einzigen Werk für Orchester, das die erst 16jährige Clara Wieck-Schumann komponierte. Dessen Mittelsatz, die Romanze, ist jener schwärmerische Dialog zwischen Cello und Piano.
tzm