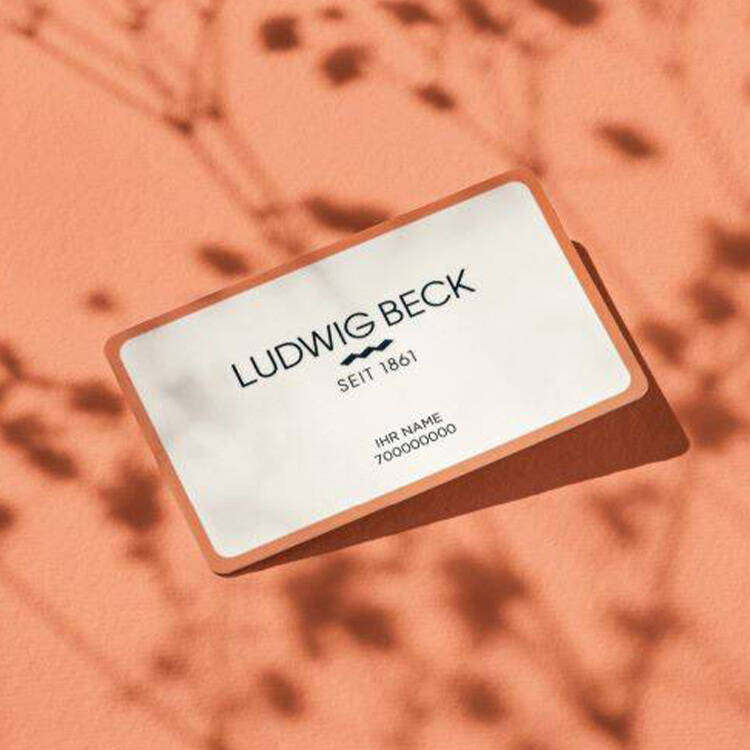Ein Gespräch mit dem Bariton Benjamin Appl
Von Thomas Otto
Wie gut, dass Benjamin Appl sich damals entschied, sein Studium der Betriebswissenschaft abzubrechen – heute gilt er als einer der wichtigsten Botschafter für die Kunstform des Liedes. Ehemals Mitglied der Regensburger Domspatzen, studierte er später Gesang bei Edith Wiens, Helmut Deutsch und Rudolf Piernay und war der letzte Privatschüler Dietrich-Fischer Dieskaus. Benjamin Appl ist nicht nur als Opernsänger an renommierten Opernhäusern tätig, darunter in London, München und Berlin, sondern machte auch als Konzertsolist auf sich aufmerksam. Jetzt legt er eine von BR-Klassik produzierte Aufnahme von Liedern Franz Schuberts vor. Das Besondere daran: es sind ausschließlich Lieder in der Orchesterfassung.
Thomas Otto sprach mit dem Bariton Benjamin Appl über sein besonderes Verhältnis zu Franz Schubert, über die Herausforderungen der Gattung Orchesterlied an den Liedsänger und über Dietrich Fischer-Dieskau.
*
Herr Appl, Sie haben als Knabe bei den Regensburger Domspatzen gesungen. Wenn ich Sie nach Ihrer Erstbegegnung mit der Musik Franz Schuberts frage, dann mit der Vermutung, dass es einige seiner sechs lateinischen Messen waren, vielleicht die Nr. 5 in As-Dur Messe oder die Nr. 6 in Es-Dur?
Nicht wirklich! Wir haben damals eigentlich nur Auszüge aus seiner „Deutschen Messe“ gesungen und einige Motetten, wie das „Salve Regina“ (in A-Dur, D 676). Bei den Regensburger Domspatzen - damals noch unter Georg Ratzinger, und auch bei seinem Nachfolger - hatten wir eigentlich fast nur reine Vokalmusik ohne Orchesterbegleitung gesungen. Der “Lindenbaum” war mir eher als Volkslied bekannt, ich wusste zu dieser Zeit nicht, dass es ein Kunstlied von Schubert ist. Als Mitglied der Domspatzen im Musikgymnasium erhielt ich einen qualitativ hohen Musikunterricht von einem sehr guten Musiklehrer, der mich frühzeitig in die Liederwelt Franz Schuberts einführte. Bei ihm hörte ich damals zum ersten Mal den Zyklus “Winterreise“ mit Fischer-Dieskau. Dies hatte mich fasziniert und nachhaltig geprägt. Nach meinem Stimmbruch war dieser Musikpädagoge dann mein erster Gesangslehrer. Er ermöglichte mir nicht nur den Zugang zum deutschen Liedgut, sondern er sensibilisierte mich förmlich für die Besonderheit dieser Kunstform. Mit großer Freude arbeitete ich besonders intensiv am Lied.
Ihr Repertoire als Liedsänger ist sehr breit gefächert, die Namen der Komponisten reichen von Fanny Mendelssohn über Robert Schumann, Edward Grieg, Francois Poulenc und Hugo Wolf, bis zu Arnold Schönberg und Hanns Eisler. Die Reihe ließe sich fortsetzen - welchen Stellenwert hat Franz Schubert für Sie darin?
Von Anfang an und bis heute deckt Schubert den wichtigsten und größten Teil meines Liedrepertoires ab - nicht nur der Anzahl seiner Liedkompositionen wegen - auch nicht wegen seiner musikgeschichtlichen Bedeutung, die sich mit seinem Namen verbindet. Nein. Es basiert auf einer ganz persönlichen Ebene: Tatsächlich ist er mein Lieblingskomponist! Wenn ich ein Klavierlied nehme mit seiner sehr spärlichen Klavierbegleitung, die auf jeden Schnörkel, jeglichen “Schlagobers” verzichtet und ganz direkt ist - da kommt nicht viel klangliche Unterstützung vom Klavier, da fühlt man sich fast nackt auf der Bühne. Es ist die große Natürlichkeit und Direktheit, die diese Lieder so attraktiv machen und zugleich eine ungeheure Zerbrechlichkeit, die ich bei Schubert empfinde. Er komponiert nie, um zu beeindrucken, sondern um etwas auszudrücken. Bei Schubert gibt es keinen Fake, nichts Gekünsteltes, alles ist wahnsinnig direkt, ehrlich, einfach direkt aus dem Herzen, wie von einem guten Freund.
Es ist so eine gefühlte Nähe zur Person Schuberts, mit der ja auch viel Tragik verbunden ist, nicht nur, wenn ich seine Musik höre, sondern auch, wenn ich über ihn lese, in seinen Briefen, in seinen Texten - wie etwa in jenem, der im Juli 1832 entstand: „Mein Traum“. Hier gibt er ganz viele Gefühle preis und gewährt einen tiefen Einblick in sein Inneres. Oder nehmen Sie die Zeugnisse darüber, wie er mit seinen Freunden unterwegs ist. Wir wissen auf der einen Seite so viel über ihn und andererseits wieder doch so wenig.
Hat Ihre Nähe zu Schubert auch mit den Liedtexten zu tun, die er für seine Kompositionen ausgewählt hat? Bei vielen hat man den Eindruck, sie seien direkt für ihn geschrieben worden…
Für mich als Liedsänger ist das Verhältnis von Text und Musik tatsächlich eins zu eins. Manche Texte, manche Formulierungen darin scheinen heute aus der Zeit gefallen. Die entscheidende Rolle für mich jedoch spielt, was zwischen den Zeilen steht, welche Emotionen hervorgerufen werden. Wenn man die Lieder unter diesem Aspekt hört, dann merkt man wie aktuell sie sind. Das sind alles Gefühle, die in uns stecken - auch im 21. Jahrhundert mit seinen sozialen Medien. Das Verliebtsein, die Angst vor dem Tod, oder das Verlangen danach, die großen Fragen des Lebens zu stellen – Befindlichkeiten wie diese, fühlen wir doch auch heute in uns. Das macht Schuberts Musik zu den Texten, die er ausgewählt hat, die teilweise ja auch von seinen Freunden stammten, so besonders, auch wenn sie vielleicht nicht immer den literarischen Wert eines Gedichtes von Goethe oder Schiller haben.
Einschließlich der drei großen Lieder-Zyklen komponierte Schubert rund 700 Lieder. Er entwickelte dabei die Möglichkeiten des Klaviers über das Begleiterische hinaus zu dramatischer Gestaltung der künstlerischen Aussage der Lieder – man denke nur an den „Erlkönig“. Wie kommt es wohl, dass Schubert nicht selbst Hand an seine Lieder gelegt hat, um sie zu orchestrieren?
Ich denke, der wichtigste Grund war wohl, dass diese Musik für den Salon geschrieben wurde, für die Hausmusik. Was ich immer wieder spannend finde, dass viele seiner Lieder, darunter auch Beethoven-Lieder, wie etwa das „Abendlied unter dem gestirnten Himmel“, in einer Wiener Zeitschrift für Mode veröffentlicht wurden, wie es sie zu jener Zeit für die Damen gab, mit Skizzen zur neuesten Mode aus Paris. Zwischen diesen Bildern wurden immer wieder Lieder veröffentlicht. Die Verleger bedienten damit offensichtlich das Biedermeier-Klischee, dass eine vornehme Dame aus gutem Hause auch Hausmusik betreibt, dass sie Klavier spielen und dazu singen kann. Schuberts Lieder wurden für einen kleinen, intimen Rahmen geschrieben. Er hatte ja auch versucht, Opern zu komponieren, denen ein größerer Erfolg versagt blieb. Ein weiterer Grund könnte eine daraus resultierende Unsicherheit gewesen sein, diese Liedkompositionen größer zu instrumentieren.
Sie haben die Auswahl der orchestrierten Schubert-Lieder selbst vorgenommen. Nach welchen Kriterien haben Sie entschieden? Wie groß ist eigentlich der Pool, aus dem Sie geschöpft haben?
Der Pool ist relativ groß. Neben Komponisten wie Franz Liszt, Johannes Brahms, Anton Webern, Benjamin Britten oder Max Reger gibt es immer mehr zeitgenössische Komponisten, die sich mit der Orchestrierung von Schubert-Liedern beschäftigen. Ich denke, wir haben von den großen Komponisten der letzten zweihundert Jahre mehr oder weniger einen Querschnitt abgedeckt.
Die Auswahl zu treffen war nicht einfach. Es sollten Stücke dabei sein, die zu meinen Lieblingsliedern zählen, aber es ging auch um eine gewisse Abwechslung, wenn man ein solches Album konzipiert. Und nachdem mancher Schubert doch auf der melancholischen Seite sieht, habe ich versucht, darauf zu achten, ihn auch von der anderen Seite zeigen und fröhlichere, schnellere Lieder zu finden und letztlich einen Querschnitt der Emotionen abzubilden.
Ihr Repertoire als Liedsänger ist vorrangig von der spannungsvollen Beziehung zwischen der Stimme und dem Piano geprägt. Erfahrungen mit dem Orchesterlied haben Sie aber auch schon vor dieser Aufnahme gemacht, ich denke da an Ihre Interpretation der Orchesterlieder von Hugo Wolf. Stellt die Kategorie des Orchesterliedes Sie als Gesangssolisten nicht vor besondere Herausforderungen? Anstelle des intimen und intensiven Dialogs mit dem Klavier tritt die Stimme auf großer Bühne gegen großes Orchester an...
Ich habe auch die Schubert-Lieder mit Orchester schon ein paarmal im Konzert gesungen. Also man singt schon mit der gleichen Stimme, aber die Vorstellung ist eine andere. Bildhaft gesprochen: Während ich bei den Liedern mit Klavierbegleitung oft an Aquarelle denke, die ich mit kleinem Pinsel male, mit sehr pastelligen Farben, sind es doch beim Orchesterlied, wie auch bei der Oper, große Leinwände mit kräftigen Ölfarben.
So ein Orchester ist natürlich ein großer Apparat, manchmal nicht ganz so flexibel wie ein Pianist, den man auch noch gut kennt. Aber ich muss sagen, dass die Arbeit mit dem jungen Dirigenten Oscar Jockel ganz wunderbar war. Wir haben die Lieder zuvor am Klavier durchgemacht, so dass er als Dirigent auch die pianistische Perspektive hatte und ich wiederum wusste, wie ich auf sein Dirigat reagieren konnte. Das Münchner Rundfunkorchester ist ein äußerst vielseitiges. Es ist in sehr vielen Musikstilen zuhause und es war ganz wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Alle hatten zuvor die Texte ausgedruckt bekommen, damit sie sich damit beschäftigen konnten und jeder eine Ahnung davon hatte, um was es in den Liedern geht, auf welche Worte es ankommt, wo die Pointen liegen. Insgesamt waren das sehr schöne sechs Aufnahmetage.
Sie waren der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau, der ja auch im Genre "Orchesterlied" große Erfahrungen hatte. Hatten Sie Gelegenheit, von ihm zu diesem speziellen Thema zu lernen? Spielte das bei seinem Unterricht mit Ihnen eine Rolle?
Wir haben vor allem am Klavierlied und an der Oper gearbeitet - meistens mit einem
Pianisten - und haben das ganze Repertoire abgedeckt, das ich zu dieser Zeit hatte. Das Orchesterlied per se war weniger das Thema. Es ging um Technik, um Interpretation, um das Erfassen der Texte, um Bühnenpräsenz – alles Parameter, die für das Orchesterlied genauso wichtig sind. Wenn ich diese Lieder mit Klavier singe, ist die Interpretation manchmal etwas anders. Die Gefühlswelt mancher Lieder wurden subtil durch Veränderungen gewisser dynamischen Zeichen von den Bearbeitern der Klavierlieder verändert – Anton Webern hat ganz gezielt in seinen Orchesterbearbeitungen andere Dynamiken gewählt. Das kennenzulernen, war für mich außerordentlich spannend.