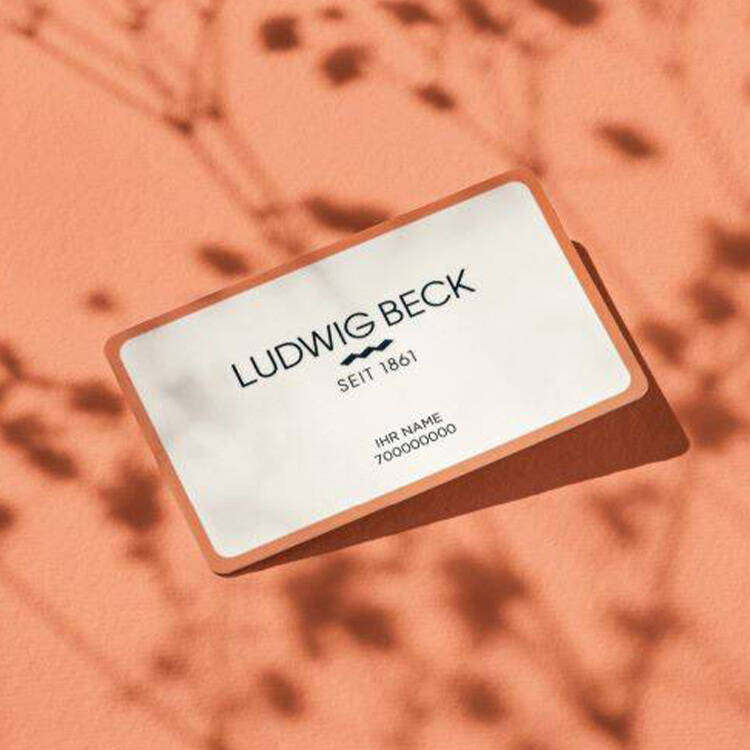Jene Messe, die Mozart 1779 für den Ostergottesdienst im Salzburger Dom komponierte, ist von Legenden umrankt. Vom ersten Takt an verströmt sie jenen herrschaftlichen Grundton, der ihr sehr viel später den heute geläufigen Beinamen „Krönungsmesse“ eingebracht hat.
Bald nach Mozarts Tod avancierte sie in der Wiener Hofmusikkapelle zur favorisierten Messe für die Zeremonie von Krönungsfeierlichkeiten.
Die neue CD von BR-KLASSIK ist die Live-Aufnahme eines Konzertes mit geistlicher Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, das am 21. Mai 2022 im Herkulessaal der Münchner Residenz stattfand.
Hierbei erklangen auch drei weitere, weniger bekannte Kompositionen Mozarts, die gleichfalls während dessen Zeit in Salzburg entstanden sind.
Sie sind hier zwischen die vom reformerischen Zeitgeist verlangten kurzen Sätze der „Krönungsmesse“ eingewoben und dadurch mit der Messe auf eine Weise verbunden, wie sie die aufführungspraktischen Gegebenheiten in einem Salzburger Gottesdienst möglicherweise verlangt haben könnten.
In seinen aus dem gleichen Jahr stammenden „Vesperae solennes de Dominica“ kam Mozart der Forderung des Salzburger Fürsterzbischofs nach größtmöglicher Knappheit mit verschiedenen kompositorischen Kniffen und einer besonders klangprächtigen Partitur augenzwinkernd entgegen.
Ergänzt wird das Album durch die zur „Krönungsmesse“ entstandene „Epistelsonate“ für Orchester mit obligater Orgel C-Dur KV 329 sowie dem feierlichen Offertorium „Alma Dei creatoris“ für Soli, Chor und Orchester F-Dur KV 277.
Lesen Sie hierzu auch das Gespräch zwischen dem Dirigenten Howard Arman und Thomas Otto:
BR
Bei Mozart geht es um universelle Wahrheiten
Ein Gespräch mit dem Dirigenten Howard Arman
Von Thomas Otto
Sechs Jahre lang war der Dirigent, Chorleiter und Komponist Howard Arman künstlerischer Leiter des BR-Chores. Zu den zahlreichen Aufnahmen aus dieser Zeit gehören drei der wichtigsten kirchenmusikalischen Werke Mozarts: das Requiem in d-Moll in einer Bearbeitung durch Howard Arman selbst, die Messe in c-Moll und schließlich die so genannte „Krönungsmesse“ in C-Dur. Darüber sprach Howard Arman im Interview mit Thomas Otto.
Während der Konzerte im Prinzregententheater im Mai dieses Jahres „zelebrierten“ Sie die „Krönungsmesse“ - nicht im liturgischen, wohl aber in einem aufführungspraktischen Kontext. Sie ergänzten das Werk durch die „Epistelsonate für Orchester mit obligater Orgel“ C-Dur sowie durch das Offertorium „Alma Dei creatoris“ für Soli, Chor und Orchester. Auf welche Quellen konnten Sie bei der Konzeption des musikalischen Ablaufs der Messe zurückgreifen?
Worauf ich mich gestützt habe, geht nicht auf die „Krönungsmesse“ an sich zurück. Über die Problematik der damaligen Aufführungspraxis schrieb Mozart im September 1776 in einem Brief an den italienischen Komponisten Giovanni Battista Martini, genannt Padre Martini. Darin beklagte er sich über all die Vorgaben, die er als Hofmusikus in Salzburg zu erfüllen hatte, wenn er eine feierliche Messe komponierte, besonders dann, wenn der Salzburger Fürsterzbischof die Messe selbst abhielt. In diesem Brief beschreibt er die Forderung nach größtmöglicher Knappheit bis hin zu der vorgeschriebenen Zeit. Er sagt auch: „Ihr habt es da in Italien viel leichter.“
Ich finde, in einem Konzert braucht man ein Gefühl für die musikalische Architektur, für den Ablauf einer solchen Messe, weil wir ja das Gerüst des Wortgottesdienstes nicht haben. Es ist heute sehr schwer, sich vorzustellen, wie die großen einzelnen musikalischen Sätze der Messe damals auf den Hörer gewirkt haben, die ja immer wieder durch die Liturgie unterbrochen wurden. Deshalb haben wir auch bei der vorangehenden Aufnahme von Mozarts c-Moll-Messe (die Vesprae auf der CD waren mit Antiphonen versehen!), alle musikalischen Antiphonen mit aufgenommen, damit diese großen Sätze nicht so nah beieinanderstehen. Eine ähnliche Funktion hatten für diese Aufnahme das „Alma Dei creatoris“ und die „Epistelsonate“. Die Entstehung der Messe und die der „Epistelsonate“ liegen zeitlich dicht beieinander – sie sind beide von feierlichem Charakter, haben die gleiche Orchestrierung und sind außerdem in der gleichen Tonart komponiert worden. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Epistelsonate für eine Aufführung der Krönungsmesse bestimmt war.
War das für Mozart vielleicht auch der Versuch, die einschränkenden Vorgaben zu umgehen?
Ich glaube, Mozart war jemand, der sich bestimmten Vorgaben, soweit er sie nicht als Anregung empfand, auch widersetzten konnte. Er hat sozusagen versucht herauszufinden, wie weit er gehen kann. Ich glaube auch, dass ihm schon sehr bewusst war, was für eine Visitenkarte er da 1779 mit dieser Messe abgab in Hinblick auf seinen Amtsantritt kurz davor als Hoforganist in Salzburg.
Die „Krönungsmesse“ war nicht nur eine „Bewerbung“ um das Amt des Hoforganisten im Mozart so verhassten Salzburg. Der Umstand, dass die Messe am Ostersonntag des Jahres 1779 durch den Erzbischof selbst zelebriert wurde, hatte ja Auswirkungen auf die Anlage und vor allen auf die Instrumentation: sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten! Auch die Kirchenkantaten Johann Sebastian Bachs dienten der Ausschmückung der Gottesdienste. Könnte man Mozarts „Krönungsmesse“ gewissermaßen ebenfalls als „Funktionsmusik“ betrachten?
Die Frage ist schon interessant, weil ja auch Bach seine Hörer sehr weit geführt, ihnen zum Beispiel mit seiner Harmonisierung bekannter Choräle viel abverlangt hat. Aber ich würde einen Unterschied zwischen der Funktion der Bachkantate im Gottesdienst an der Thomaskirche in Leipzig und der „Krönungsmesse“ im Salzburger Dom machen. Die Bachkantate war das klingende Pendant zur Predigt und den für den jeweiligen Sonntag vorgeschriebenen Bibelpassagen. Bei Mozart hatte das Verhältnis zwischen Text und Musik einen anderen Charakter – hier ging es um das der Messe, das ja Woche für Woche gleich ist. Die „Krönungsmesse“ sollte natürlich eine Missa solemnis, also eine feierliche Messe sein – groß instrumentiert, über das Normale hinausgehend. Aber sie ist darüber hinaus keine inhaltliche Auslegung der Liturgie des Tages.
Innerhalb seines Oeuvres nimmt die Kirchenmusik in Mozarts Schaffen einen geringen Raum ein. Lange galt seine Kirchenmusik als „nicht liturgiegemäß“, zu opernhaft, zu weltlich. Sechs Jahre nach seiner C-Dur-Messe verwendet er das herrliche Motiv des „Agnus Dei“ für die Arie der Gräfin „Dove Sono“ im dritten Akt der Oper „Le nozze di Figaro“ und es klingt, als sei es genau für diese Oper komponiert worden…
Es ist diese Art von Zerbrechlichkeit bei Mozart, von Eindringlichkeit. Das Wort „opernhaft“ klingt so nach Oberflächlichkeit – aber die Gräfin ist die zerbrechlichste Person dieser Oper. Nun sind die Übereinstimmungen zwischen beiden Werken nicht so gravierend, aber dieser Zerbrechlichkeit begegnet man auch bei der c-Moll Messe, für die Sängerin Konstanze Mozart geschrieben. Was Mozart ihr dort auf die Seele schreibt, war vielleicht – das ist eine Mutmaßung – nicht das, was sie war, sondern wie er sie gern gesehen hat. Das ist etwas, das tief in seine Seele blicken lässt und das ist herzzerreißend.
Es wird oft über den unverwechselbaren Charakter, den „besonderen“ und eigenen Klang der Kirchenmusik Mozarts gesprochen – wie stellt der sich auch Ihrer Sicht dar? Was macht ihn aus?
Natürlich kann man immer über die satztechnische Perfektion, das Verhältnis von Wort und Ton, von Orchester und Singstimmen usw. reden, wo Mozart seinen Zeitgenossen haushoch überlegen war. Für mich persönlich jedoch ist es immer wieder ein Wunder, dass die Aussage der eigenen Persönlichkeit Mozarts absolut nicht das ist, was den Hörer im Vordergrund beschäftigt, sondern die Botschaft der Musik allein. Es ist immer sehr gefährlich, wenn man Gedanken in die Musik hineinliest, Vermutungen darüber anstellt, was der Komponist bei dieser Musik gedacht haben könnte, auch und gerade bei Mozart. Selbst wenn man eine existenzielle Angst vor der Größe Gottes oder vor dem jüngsten Gericht in bestimmten musikalischen Stellen zu finden meint – ich denke, es geht doch eher um große universelle Wahrheiten, die da in der Musik umgesetzt werden. Da ist nichts von: „Liebes Tagebuch, so geht es mir…“ Es ist ein Wunder, wie die Musik durch ihn spricht, aber nicht von ihm. Das ist mein alles überragender Eindruck von dieser Musik
Mozart starb, bevor er das Amt des Domkapellmeisters in Wien antreten konnte. Wenn er es aber erlebt hätte, wäre die Geschichte der Kirchenmusik im ausgehenden 18. Jahrhundert eine andere geworden. Die sakrale Musik war für ihn das Behältnis seiner größten musikalischen Gedanken.
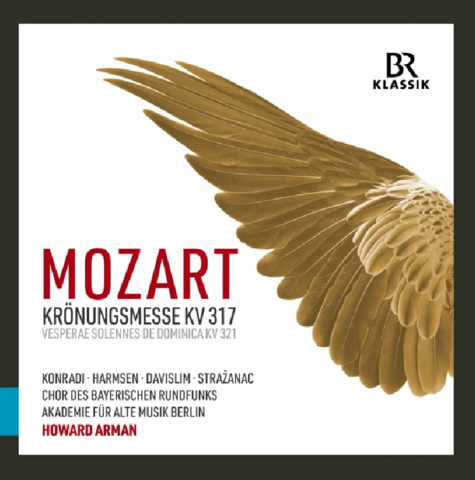
Howard Arman – Mozarts „Krönungsmesse“ KV 317
BR KLASSIK
CD 17,95€
(Bilder: Astrid Ackermann)