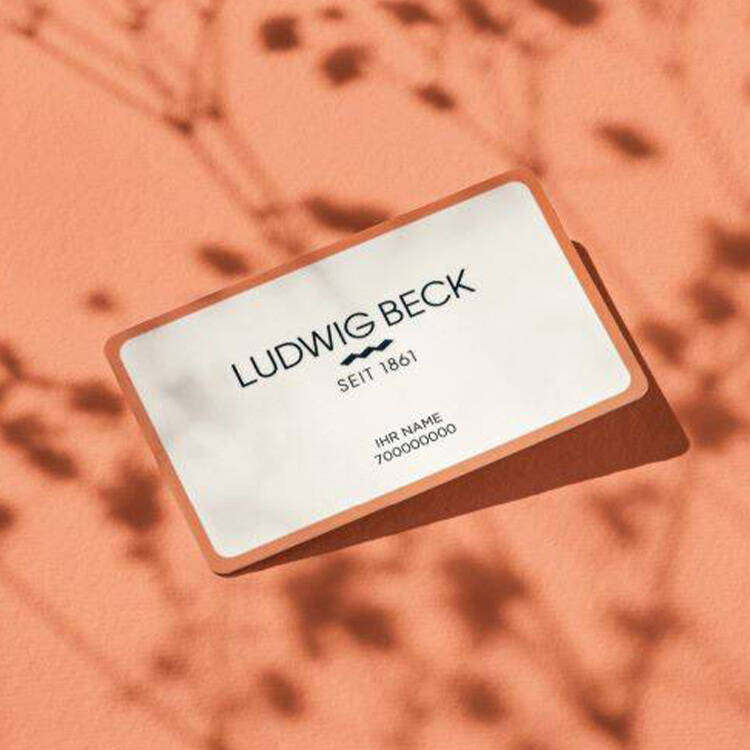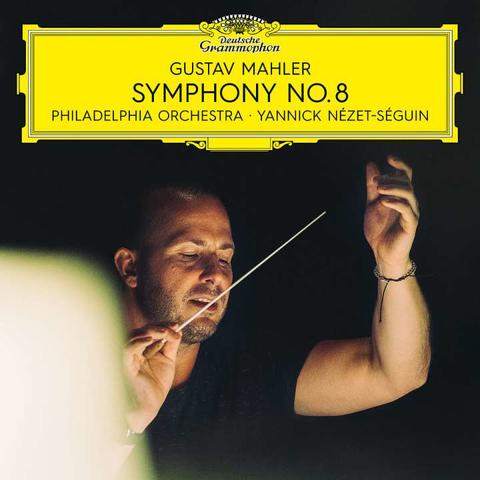
Nezet-Seguin, Yannick / Philadelphia Orchestra
"Gustav Mahlers 8. Sinfonie"
Deutsche Grammophon
Gustav Mahlers 8. Sinfonie.
Sie sei das Größte, das er bisher gemacht habe, schrieb Gustav Mahler im August 1906 an den Dirigenten Willem Mengelberg. In nur drei Monaten vom 14. Juni bis zum 2. September des gleichen Jahres hatte Mahler in einem unvorstellbaren Kraftakt das Riesenwerk skizziert und schon alle Particella notiert. Ein Getriebener, besessen von einer Idee. Er habe, schrieb er später, „…noch nie unter solchem Zwange gearbeitet“. Es sei wie eine „blitzartige Vision“ vor seinen Augen gestanden, die er nur habe aufzuschreiben brauchen, so, als ob sie ihm diktiert würde. Die Reinschrift nahm er ein knappes Jahr später in nur zwei Monaten vor.
Und tatsächlich suchte, was sich dem begeisterten Uraufführungspublikum bot, seinesgleichen. In jeder Hinsicht ist dieses Werk außergewöhnlich. Am auffälligsten ist seine Besetzung – den Beinamen „Sinfonie der Tausend“ verdankt Mahlers achte Sinfonie dem Konzertagenten Emil Gutmann, der die Uraufführung des Werkes durch 858 Sänger und 171 Instrumentalisten am 12. September 1910 in München miterlebte. Und bis heute stellt die Besetzung extreme logistische Anforderungen an jedes Konzerthaus, das dieses Werk auf seinen Spielplan setzt: acht Solisten, zwei große gemischte Chöre, ein Knabenchor, mehrfach besetzte Holz- und Blechbläser, ein riesiger Streicherapparat, Harfen, Mandolinen, Orgel, Harmonium, dreifach Pauken, Glockenspiel und vielfältigstes Schlagwerk.
Ein Ausnahmewerk aber ist die achte Sinfonie auch durch ihren Aufbau. Was Beethoven mit dem 4. Satz seiner Neunten begonnen hatte – das Miteinander von instrumentaler und vokaler Musik als neues Merkmal einer Sinfonie – wird bei Mahler zum Charakteristikum für das ganze Werk, das sich zudem nicht an die übliche viersätzige Struktur der Sinfonie hält, sondern aus zwei Teilen zusammengesetzt ist, die - thematisch völlig unterschiedlichen Inhalts – einander auf wundersame Weise ergänzen. Liegt dem ersten Teil ein alter liturgischer Text, der lateinische Hymnus Veni creator spiritus aus dem 9. Jahrhundert zugrunde, so hat sich Mahler für den zweiten Teil die Schlussszene aus Goethes Faust vorgenommen. Der große vokale Anteil lässt auch Bezüge zu musikalischen Gattungen wie der Kantate, dem Oratorium oder der Messe erkennen, auch wenn Mahler eine solche selbst nie komponiert hatte. Gleichwohl sah er seine Achte durchaus auch in einer solchen Tradition.
Das Werk stellt allerhöchste Anforderungen an Sänger, Instrumentalisten und den Dirigenten gleichermaßen. Auch als solcher erzielte Gustav Mahler mit seiner Botschaft „Kreativität durch Liebe“ bei der Aufführung seines opus summum jenen überragenden Erfolg, auf den er als der Komponist so lange warten musste.
tzm