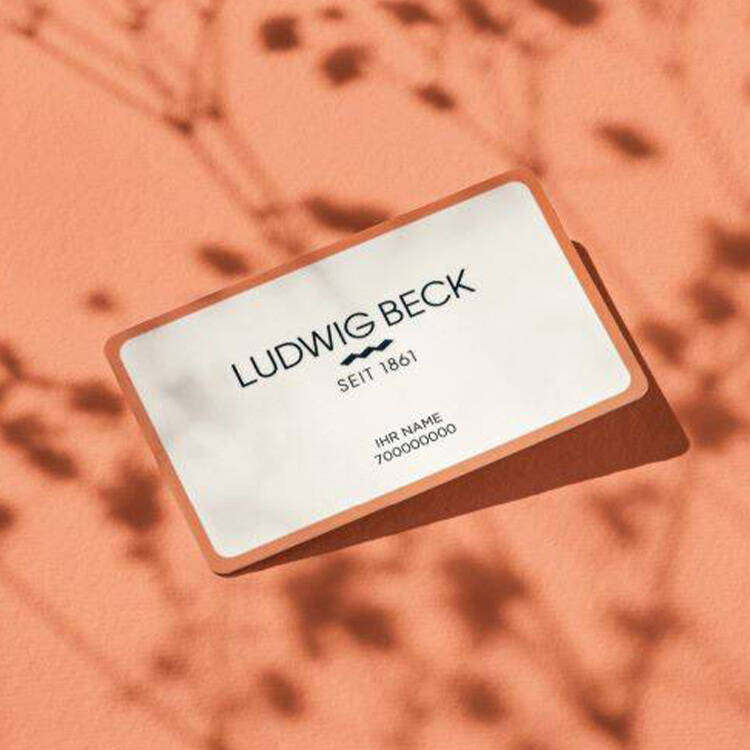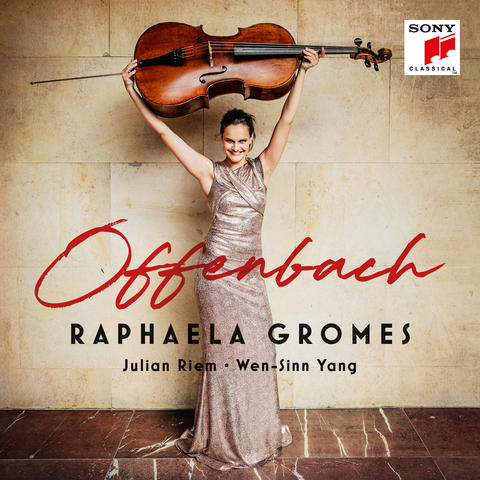
Eine CD von Raphaela Gromes
mit dem Werk
- Offenbach -
Sony Classical
Miniaturen von wirklicher Größe
Wer den Namen „Jaques Offenbach“ hört, denkt zumeist sofort an Operetten wie „Die schöne Helena“, „Orpheus in der Unterwelt“, „Blaubart“ oder die Opéra Fantastique „Hoffmanns Erzählungen“. Und tatsächlich kommt dem 1819 als Sohn des deutsch-jüdischen Kantors Isaac Ebers in Köln geborenen Jakob Offenbach das Verdienst zu, die Operette als eigenständiges Genre des modernen Musiktheaters etabliert zu haben. Weniger bekannt sind seine kammermusikalischen Werke für Cello und Klavier und ebenso für zwei Celli – von denen komponierte er insgesamt 36 Stücke.
Offenbach hatte zunächst als Sechsjähriger Geigenunterricht bei seinem Vater erhalten und mit zehn Jahren das Cello für sich entdeckt. Als er vierzehn wurde, schickte sein Vater ihn Paris, wo er, seines großen Talents wegen, von Luigi Cherubini am Conservatoire de Paris als Cellist aufgenommen wurde und das Instrument zu studieren begann. (In dieser Zeit nahm Jakob Offenbach auch seinen französischen Vornamen Jaques an.) Eine Karriere als Cellist schien sich anzubahnen. Er festigte seinen Ruf als Virtuose, konzertierte mit Pianisten wie Anton Rubinstein, Franz Liszt und Felix Mendelssohn.
Dann aber schlug er einen anderen Weg ein, wurde 1849 zunächst Dirigent am Théâtre Français und eröffnete 1855, anlässlich der Weltausstellung, ein eigenes Theater, das Théâtre des Bouffes-Parisiens, wo er nicht nur als Direktor fungierte, sondern auch zahlreiche Operetten produzierte. Seinen Durchbruch erzielte er mit „Orpheus in der Unterwelt“ - der große Erfolg machte ihn in ganz Europa bekannt. Ab 1861 widmet er sich ausschließlich dem Komponieren. Sein Oeuvre enthält mehr als 50 Operetten, drei Opern, einige konzertante Werke und Ballette.
Die Kompositionen für das Cello stammen jedoch aus der Zeit vor seinen Theaterjahren. Als Cellovirtuose unterwegs, gefeiert als „Liszt des Cellos“, war es üblich, dass er sich in den musikalischen Salons auch mit eigenem Repertoire präsentierte. Der Name „Salonmusik“ hat in diesem Sinne durchaus eine gute Tradition und Charakterstücke wie der „Danse bohémienne“, „Deux Âmes au ciel“ , „Introduction e valse mélancholique“, „Revérie auf bord de la mer“ oder „Les Larmes de Jacqueline“, die auf diesem Album zu hören sind, werden ihm in seinem besten Sinne gerecht. Offenbachs Kammermusikstücke kommen als melodische und zugleich musikalisch anspruchsvolle Miniaturen daher - oft meint man, sie mitsummen zu können. Sie bilden nicht zuletzt gewissermaßen den musikalischen Humus, aus dem später Offenbachs bekannteste Werk erwuchsen.
tzm